Er stammt aus einem der kleinsten Kantone der Eidgenossen, aber seine Musik ist groß. Der Nidwaldner Andreas Gabriel hat die innerschweizerische Geigentradition mit seiner Band Ambäck und seinem „Verändler“-Projekt rundum erneuert. Damit ist er Teil einer neuen Schweizer Volksmusikszene, die mit den helvetischen Wurzeln respektvoll, einfallsreich und virtuos neue Klangwelten auslotet.
Text: Stefan Franzen; Titelfoto: Benno Ott
Mit dem Bandnamen fängt das Ringen um die richtigen Worte zwischen Schwyzerdütsch und Hochdeutsch schon an. „Ambäck, das ist der …, der Spaltstock“, formuliert es Andreas Gabriel vorsichtig, fast fragend. „Also dieser Klotz, auf dem man das Holz spaltet. Das ist der Muotathaler Begriff dafür, und den haben wir genommen, weil wir am Anfang viel Musik aus diesem abgelegenen Tal gespielt haben.“ Wir sitzen in einem Luzerner Café in der Nähe des Hauptbahnhofs. Draußen strömt der Verkehr durch den Regen, drinnen herrscht geschäftiger Betrieb und der Lärm der Mittagspäusler. Man kann sich in dieser Stadt kaum einen urbaneren Fleck vorstellen. Und doch: Durch Gabriels Erzählungen ist man sofort mittendrin in der ländlichen Schweiz. „Spaltstock, das hat doch auch etwas Brachiales. Etwas Uriges, etwas Sperriges, und deshalb hat das sehr gut gepasst“, sagt er.
Bei Ambäck wird das Holz allerdings etwas gefühlvoller behandelt, und dafür bürgen drei Koryphäen der Neuen Schweizer Volksmusik. Sie stehen für grenzoffenes Spiel, bringen Erfahrungen aus Jazz oder Klassik mit: neben Gabriel der Aargauer Markus Flückiger am Schwyzerörgeli (das diatonische Akkordeon der Schweizer Volksmusik) und Pirmin Huber aus dem Kanton Schwyz am Bass. „Ich wage jetzt mal zu behaupten, dass es nur mit ihnen beiden möglich ist, so zu spielen. Es ist ein glücklicher Umstand, dass wir uns gefunden haben. Wir haben am Anfang urchig gespielt, eben diese alten Muotathaler Geigenstücke, und gemerkt, dass es wahnsinnig geigt, im wahrsten Wortsinn halt. Wir mussten nie über etwas reden, es war einfach klar, von der Dramaturgie her und der Phrasierung. Deshalb haben wir uns entschlossen, weiterzumachen und eigene Kompositionen reinzubringen. Wir drei komponieren sehr unterschiedlich, und deshalb ist es auch sehr spannend, wie dann die Stücke rauskommen, was dann der andere dazu macht. Wir geben uns viele Freiheiten.“
Andreas Gabriels Weg auf der Geige begann früh. Als Kind spielte er bereits Volksmusik, allerdings „aufgearbeitete“, wie er es nennt, und er interessierte sich von klein auf für Folk aus Skandinavien. Ein klassisches Studium schloss sich an. Das war dann fast hinderlich, um wieder in einem zweiten Anlauf zu den Wurzeln zurückzukehren und nicht alles „überzuinterpretieren“, wie er sagt. Für den Nidwaldner nicht die einzige Herausforderung: „Das Spezielle an der Innerschweiz ist ja, dass die Geigentradition eigentlich ausgestorben ist. Deshalb war ich der Exot, der die Geigenmusik wiederbelebt hat. Ich konnte mich auf keine Vorbilder berufen, und deshalb habe ich mir vor allem bei den Schwyzerörgeli-Spielern Anregungen geholt oder auch bei den Bläsern. Und das habe ich dann alles selbst adaptiert für die Geige.“ Erstmals war sein persönlicher Stil im Rahmen des bis heute bestehenden Quartetts Helvetic Fiddlers zu hören, bei dem er mit Patric Stocker, Andy Schaub und Fabian Müller – Letzterer ist auch sein Duopartner –, die alte Fiedelmusik auf Vordermann brachte.
Gabriels Handwerkszeug besteht aus drei Instrumenten, einer normalen Geige, die zweite stimmt er einen Halbton hoch, die dritte einen Halbton runter. „Das hat den Grund, dass die Schwyzerörgeli auch verschiedene Stimmungen haben. Ich habe mir gedacht, wenn ich mit ihnen As-Dur oder Des-Dur spielen muss, dann will ich mich frei entfalten in einer fiedlerischen Art. Früher haben sie es ja auch oft so gemacht: Sie haben die Geigen einen Halbton umgestimmt zu den Örgeli. Die hohe Geige, eine B-Geige, die ist auch scharf und urchiger vom Charakter, die benutze ich für die schnelleren Stücke auf dem neuen Album wie den ‚Double‘ oder den ‚Stumpää‘.“ Seine moderne Geige dagegen, eine französische, ist gar nicht spezifisch für Volksmusik gebaut worden. Er spielt sie meistens bei den langsamen Stücken, da er dort viel an klanglichen Feinheiten feilt.
Bei der Suche nach musikalischen Quellen war die Sammlung aus dem Nachlass von Hanny Christen zentral. Die Sammlerin aus dem Baselbiet war von den Vierzigern bis in die Sechziger in allen Kantonen aktiv, machte ab Mitte der Fünfziger auch Feldaufnahmen bei alten Fiedlern, die die Traditionen noch pflegten. Ihren Schatz von sage und schreibe 12.000 Melodien, der bis ins frühe neunzehnte Jahrhundert zurückgeht, hat Gabriels Kollege Fabian Müller gesichtet. Die Veröffentlichung sorgte 2002 für einen richtigen Schub der Neuen Volksmusik. Auch in der „Altfrentsch“-Sammlung aus dem Appenzell des achtzehnten Jahrhunderts fand Gabriel Material, im Muothatal, und auch bei österreichischen Volksmusikgeigern horchte er sich einiges ab. Das alles hat seinen persönlichen Stil geformt.
Andreas Gabriel komponiert zwar auch ruhige, seelenvolle Stücke, und die Schweizer Bergwelt wirkt da wie ein Brennspiegel auf sein Gemüt. Man höre sich nur mal sein zu Herzen gehendes Stück „Brisen“ an, einem Nidwaldner Hausberg gewidmet. Doch vor allem arbeitet er mit den wichtigsten Tanzformen der Schweizer Volksmusik: Ländler, Polka, Schottisch und Walzer – stets respektvoll, aber auch augenzwinkernd. Manchmal färbt er die Originale melodisch und harmonisch ein bisschen anders, behält aber sonst die herkömmlichen, vertrauten Vokabeln bei. Mit Hörerwartungen spielen, das ist ein großes Vergnügen für ihn. „Sodass man meint, es sei traditionell, aber dann plötzlich geht es in eine andere Richtung. Und man denkt sich: Ui, was passiert denn jetzt?“
Sein Paradebeispiel, ja sein „Hit“ in diesem Zusammenhang ist der „Verändler“, der geradezu archaisch vor sich hin kreist. „Ich befasse mich viel mit dieser Stimmung, gerade wenn ich alte Jützlis [das unkommerzialisierte Naturtonjodeln der Innerschweiz; Anm. d. Aut.] horche. Dann frage ich mich: Was macht die Farbe aus, dass es so urig klingt? Und aus diesem Grund ist wahrscheinlich diese Intonation entstanden. Für mich ist es auch eine Rückbesinnung. Ich stelle mir vor, dass man diese einfachen Ländler wiederholt und wiederholt hat – das sind ganz kleine Phrasen, die immer wieder gespielt wurden –, und zwar minutenlang, stundenlang, bis die Tänzer und Hörer in einer Trance waren.“
Der „Verändler“ ist nicht nur das Eröffnungsstück auf dem neuen Ambäck-Album Chreiselheuer. Dieser verrückte Ländler, der seine Wandlung ja schon im Namen trägt, wurde auch zum Paten für Gabriels zweites Projekt: ein zehnköpfiges Ländlerorchester, für das er bis zu 45-minütige Suiten schreibt. Diese Big Band mit zumeist jungen Musikern ohne stilistische Scheuklappen ist nicht mehr und nicht weniger als ein sanfter Quantensprung für die neue helvetische Volksmusik. Wobei der bescheidene 37-Jährige das gleich relativiert: „Mir gefällt halt der Mischklang von den Streichern und vom Blech sehr gut. Das ist ja nichts Neues, das gibt es ja in jedem Orchester, und auch in jeder Tanzmusik früher war das gemischt. Die Klarinette hab ich jetzt hier mal weggelassen, aber mit dem Sopransaxofon ist diese Farbe auch drin. Daher find ich das überhaupt keine Pionierarbeit. Gerade im neunzehnten Jahrhundert gab es viele Mischungen mit Blech, Holzbläsern und Streichern und Zupfinstrumenten wie Gitarren und Halszithern [ein dreizehnsaitiger Abkömmling der Cister-Familie; Anm. d. Aut.].“
Ein Konzert des „Verändler“-Projekts, das bislang noch keine CD eingespielt hat, gerät zu einem Erlebnis, bei dem man sich, was die Dramaturgie angeht, eher als Ohrenzeuge einer Suite aus dem Artrock wähnt. Da nehmen die zehn Musiker ein Tanzthema aus dem Muotathal her, die drei Geigen bauen daraus ein minimalistisches Flechtwerk auf, fast tönt es, als seien Steve Reich oder Philip Glass in eine Stubete, einen traditionellen Musikantenstammtisch hineingeraten. Mit Volksmusik hat das ungefähr noch so viel zu tun wie ein simpler Popsong mit den elaborierten Long Songs von Genesis oder Yes in den Siebzigern. Und würde man die Stücke dieses Orchesters auf Platte pressen, sie füllten wohl auch eine ganze Seite oder mehr wie bei ihren Rockkollegen von einst.
Mit dem „Verändler“ baut Gabriel auf den Erfahrungen mit den Ländlerorchestern auf, die sämtlich vom Zürcher Festival Stubete am See in vergangenen Jahren in Auftrag gegeben wurden. Vor ihm wurden bereits Saxofonist Domenic Janett, Klarinettist Dani Häusler, Örgeli-Virtuose Markus Flückiger und Bassist Pirmin Huber, seine beiden Ambäck-Kompagnons, aber auch der Österreicher Tommaso Huber mit der Leitung eines solchen „Large Ensembles“ betraut. „Ich hatte das Glück, bei sämtlichen dieser Orchester mitzuspielen, habe also immer die Entwicklungen und die verschiedenen Möglichkeiten mitgekriegt, wie man solche Dreiviertelstunden komponieren kann. Und für mich war es eben wichtig, dass sich von Anfang bis Schluss irgendein Bogen ergibt. Was auch noch lustig ist: Viele Stücke kann man gar nicht einzeln, losgelöst aus dieser Abfolge spielen! Ich habe das später mal probiert, aber sie gehören zusammen, weil ich’s einfach auch so komponiert habe. Diesen großen Bogen habe ich intuitiv entstehen lassen.“
Die Stärke von Andreas Gabriels Schreiben für großes Ensemble liegen nicht nur darin, dass er dabei Orchestrales zu einem mächtigen Gesamtklang bündelt. Es gibt auch immer wieder feine, leise Zwischentöne, intime Dialoge verschiedener Musiker, von denen jeder der zehn hier ein brillanter Solist ist – unter ihnen immerhin solche Größen wie Saxofonist Albin Brun, Kristina Brunner am Cello oder Fränggi Gehrig am Akkordeon. Etwa, wenn sich Geige und Kontrabass inbrünstig zu der lyrischen Widmung an den oben schon erwähnten Brisen vereinigen. Oder wenn sich über einem Pizzicato-Groove von Bass und Cello mit vielen Sprüngen und jauchzenden Glissandi fast zärtliche Dialoge aufbauen. Wie eine kammermusikalische „Sweet Swiss Soul Music“ mutet das an. Grandios auch, wie eine Polka dank des herzblutenden Bläsersatzes plötzlich einen kleinen Touch Dixieland abbekommt – da liegen die Zentralalpen plötzlich hinter New Orleans.
Streicher sind in der Schweiz überhaupt seit einigen Jahren ein großes Thema. Johannes Rühl, der zusammen mit Dieter Ringli mit Die Neue Volksmusik 2015 ein wichtiges Grundlagenbuch zu den neuen Schweizer Tönen herausgebracht hat, meint: „Es wird sehr viel Streichermusik gemacht – die Helvetic Fiddlers, Ils Fränzlis da Tschlin aus dem Engadin [beide waren in Rudolstadt 2011 und 2015 zu Gast; Anm. d. Aut.] sind da zu nennen und etliche andere Ensembles. Das Kuriose ist, dass die ursprüngliche Ländlermusik Streicher gar nicht kennt.“ Doch historische Exaktheit spielt heutzutage nur noch bei den unverbesserlichen Puristen eine Rolle, längst hat sich das Gros der Szene vom Traditionalismus gelöst. Die Fränzlis da Tschlin etwa, deren Repertoire ursprünglich auf die 150 Jahre alte Musik des Geigers Franz-Josef „Fränzli“ Waser zurückging, haben inzwischen neben den Bearbeitungen der alten Stücke auch Jazz, italienische und wienerische Elemente in ihre Klangphilosophie eingearbeitet. „Die zweite Generation der Neuen Volksmusiker“, so Rühl, „pflegt eine leichtere, groovigere, tanzbarere Musik, nicht mehr so kunstbehaftet, nicht mehr mit der Tiefe und Schwere der ersten Erneuerer vor und nach der Jahrtausendwende.“
Wo sieht Andreas Gabriel das Genre in zwanzig oder dreißig Jahren? Ist eine junge Zuhörerschaft da? „Ich habe ein Gefühl, dass es wieder durchmischter wird. Natürlich haben wir ein Publikum, das meistens vierzig, fünfzig plus ist, aber es gibt auch Jüngere, definitiv. In Luzern kann man beispielsweise Schwyzerörgeli studieren, es gibt viele Junge, die sich jetzt dafür interessieren, die holt man auch an die Konzerte, und ihnen gefällt das. Da habe ich keine Angst, dass das einschläft, das Publikum.“ Man muss sich nur das Titelstück der neuen Ambäck-CD anhören: Der „Chreiselheuer“ ist eine wilde, chromatische Hommage an diejenige Maschine, die beim Heumachen zum Einsatz kommt. Einschlummern wird dabei mit Sicherheit niemand.
Albumtipps:
Ambäck, Chreiselheuer (Eigenverlag, 2019)
Ils Fränzlis da Tschlin & Corin Curschellas, 1,2,3! Dai & Hop! (R-Tunes, 2019)
Stubete am See – Festival 2016 (Musiques Suisses, 2017)
Diverse, Duo Andreas Gabriel & Fabian Müller und die „Helvetic Fiddlers“ (Musiques Suisses, 2009)




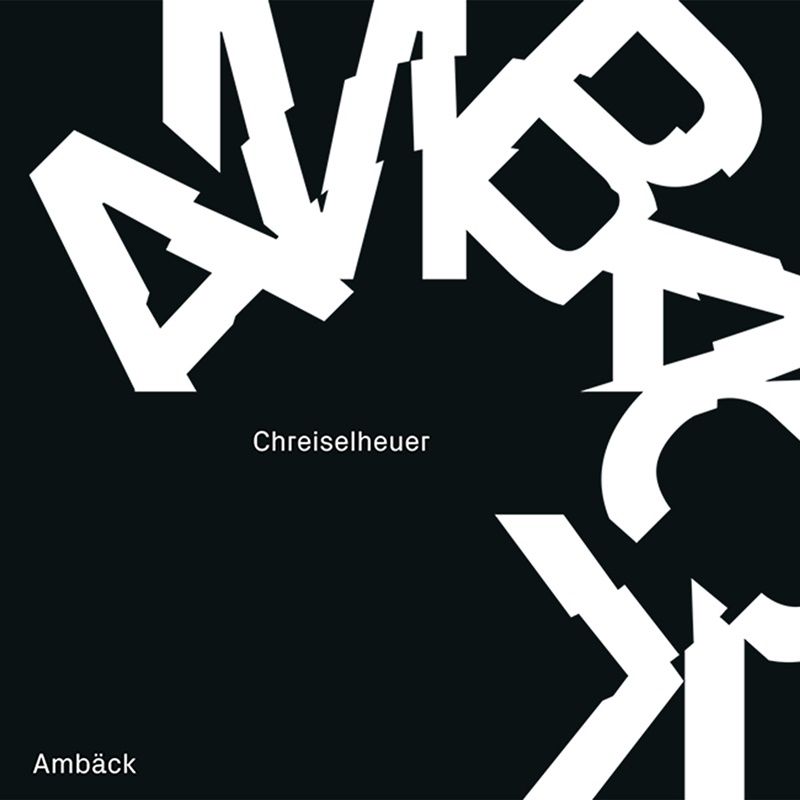







0 Kommentare