folker präsentiert „Bardentreffen 2023“
Zu den meistdiskutierten Kulturmeldungen der vergangenen Monate zählt diese: In einer alternativ verwalteten Brasserie in Bern wurde ein Konzert abgebrochen, weil es Beschwerden aus dem Publikum gab. Auf der Bühne stand eine Schweizer Band namens Lauwarm; die fünf Musiker spielten Reggae, zwei von ihnen trugen ihre Haare in Form von Dreadlocks. Deswegen hätten sich einige Zuschauerinnen und Zuschauer mit dem Dargebotenen „unwohl“ gefühlt, begründeten die Ausrichtenden später ihren Beschluss. Denn beim Reggae handle es sich um die Musik jamaikanischer Indigener, und wenn sich weiße Menschen daran bedienten, sei dies ein Fall von „kultureller Aneignung“. Das heißt: Angehörige einer herrschenden Kultur eignen sich schöpferische Errungenschaften von unterdrückten, ehemals versklavten oder sonst wie marginalisierten Kulturen an, ohne dazu das Recht zu besitzen.
Text: Jens Balzer
Nach dem Abbruch des Konzerts erhob sich sogleich ein Sturm des Spotts und der Empörung. Hier könne man „Cancel Culture“ in Reinform betrachten und auch, dass die „woke Linke“ nun endgültig durchgeknallt sei. Mit besonderer Leidenschaft wurde die Debatte gerade auch von solchen Mitgliedern des Feuilletons geführt, die bisher nicht durch ihr Interesse an alternativer Kultur oder jamaikanischer Musik aufgefallen waren. Sie nutzten bloß gerne die Gelegenheit, um „die Linken“ ein weiteres Mal als die wahren Gegnerinnen und Gegner der Meinungsfreiheit vorzuführen – weil sie unablässig anderen etwas verbieten wollen, was doch eigentlich ein Menschenrecht ist: etwa sich die Haare so zu frisieren, wie es einer oder einem gerade passt.
Bern ist kein Einzelfall. Im März 2022 wurde in Hannover die Musikerin Ronja Maltzahn von einem Konzert der Fridays-for-Future-Bewegung ausgeladen. Sie spielt nicht mal Reggae, aber hat ihre Haare wie die Lauwarm-Kollegen als Dreadlocks frisiert. Immerhin bot man ihr vorher noch an, sie könne gerne auftreten, wenn sie vorher zum Friseur gehe. (Eine persönliche Stellungnahme Ronja Maltzahns findet sich auf Seite 41 in der Printausgabe von folker #2.23 und demnächst auch auf folker.world.)
Im deutschsprachigen Raum sind solche Vorgänge noch relativ neu. In Großbritannien und den USA wird schon seit einigen Jahrzehnten über „cultural appropriation“ debattiert. Die einschlägige Definition dieses Begriffs hat im Jahr 2005 die US-amerikanische Juristin Susan Scafidi in ihrem Buch Who Owns Culture? formuliert: „Kulturelle Aneignung ist, wenn man sich am intellektuellen Eigentum, dem traditionellen Wissen, den kulturellen Ausdrücken oder Artefakten anderer bedient, um damit dem eigenen Geschmack zu entsprechen, die eigene Individualität auszudrücken oder schlichtweg Profit daraus zu schlagen.“ Für Scafidi gibt es demnach ein Eigentumsrecht an Kultur, sodass die Aneignung fremder Kulturartefakte sich auch als Diebstahl betrachten lässt. Dieses Verständnis von Kultur kann man mit Gründen als problematisch erachten, aber es hat einen wahren Kern, gerade wenn man die Geschichte der US-amerikanischen Popkultur betrachtet.
Hier haben sich weiße Menschen ja tatsächlich immer wieder bei den Schöpfungen schwarzer Menschen bedient, um sich hinterher als kulturelle Urheber zu präsentieren. Der Jazz wurzelt tief in der afroamerikanischen Kultur, doch zu einem Massenphänomen wurde er Ende der 1920er-Jahre mit dem Film The Jazzsinger, in dem der weiße Hauptdarsteller Al Jolson mit schwarz geschminktem Gesicht („blackface“) auftrat. Der Rock ’n’ Roll geht auf die Musik schwarzer Bluessänger zurück, aber zum „King of Rock’n’Roll“ wurde Elvis Presley ernannt, und als König des Blues firmierte später Eric Clapton. Auch der erfolgreichsten Rapper um die Jahrtausendwende war mit Eminem schließlich ein Weißer. „Das weiße Amerika hat schon immer nach dem Schwarzsein gegiert“, schrieb der Kritiker Greg Tate 2003 in seinem Buch Everything but the Burden, „und wann immer die Weißen sich eine Form der schwarzen Kultur wieder einverleibt hatten, versuchten sie die Präsenz schwarzer Menschen in ihr zu tilgen.“
Die Debatte um kulturelle Aneignung wurzelt also zunächst in dem Bemühen, unsichtbar gewordene kulturelle Traditionen wieder sichtbar zu machen. Auch will sie den Blick darauf lenken, warum sich Angehörige einer politisch und ökonomisch dominanten Kultur immer wieder bei der Musik, bei Tänzen, Kostümen und Accessoires aus Kulturen bedienen, die sie als weniger entwickelt betrachten: weil sie dort nämlich eine Authentizität und Ursprünglichkeit suchen, die sie an ihrer eigenen Kultur vermissen. Im Jazz hörten weiße Musikerinnen und Musiker der 1920er-Jahre eine „Wildheit“, die ihnen in ihrer eigenen Kultur fehlte – sodass sich noch in der anerkennenden Aneignung ein rassistisches oder koloniales Stereotyp versteckte: und zwar das einer vitalen, authentischen Kultur, deren Schöpfungen freilich erst durch die Aneignung überlegener – weißer – Künstlerinnen und Künstler in den Rang großer, zeitüberdauernder Kunstwerke gehoben werden können.
Selbst in wohlwollenden oder gar vermeintlich ehrerbietenden Aneignungen kann sich also eine (post-)kolonialistische Projektion verstecken. Dies ist eine Einsicht aus der Debatte, die auch für die Folkszene von Interesse sein kann – gerade weil man sich hier besonders für Musik begeistert, die „natürlich“, „authentisch“, „handgemacht“ oder gar „indigen“ erscheint. Ein reflektierter, (selbst-)kritischer Umgang mit kultureller Aneignung wäre in diesem Fall einer, der nicht einfach Mimikry an fremden Kulturen mit dem Ziel der Selbstreinigung von vermeintlichen zivilisatorischen Verformungen vornimmt, sondern der in diesen Kulturen ihrerseits Traditionen mit einer eigenen Geschichte und Entwicklung erkennt, die genauso historisch „geworden“, komplex und modern wie die eigene sind. Zu einem solchen Umgang gehört, dass man bei der Aneignung oder Präsentation „fremder“ musikalischer Traditionen auf jene Stereotype verzichtet, die diese besonders „ursprünglich“ erscheinen lassen. Das beginnt bei der Gestaltung von Plakaten und endet bei Bühnen- und Konzertinszenierungen.
Nun sollten Kritik und Selbstkritik in jeder kulturellen Praxis selbstverständlich sein. Anders als Verbote – denn diese führen höchstens dazu, dass jene, die von den Verboten betroffen sind, allen Arten der Kritik noch weniger zugänglich sind. Und manchmal zeigt sich in den Verboten selbst eine kolonialistische Projektion. Reggae dürfe nicht von weißen Menschen aufgeführt werden, weil es sich um „indigene“ jamaikanische Kultur handle – so hieß es in der Begründung für den Konzertabbruch in Bern. Nun ist Reggae in Wirklichkeit alles Mögliche, aber nicht indigen. Reggae ist ein komplexer Stil, der sich aus der Verschränkung afrikanischer, europäischer, nordamerikanischer und karibischer Einflüsse ergeben hat – und der in den verschiedensten Arten der kulturellen Aneignung bis heute weiterwirkt. So ist der Hip-Hop, die zweifellos mächtigste Popkultur der Gegenwart, in den Siebzigerjahren in New York entstanden, als jamaikanische Eingewanderte Elemente des Reggae – etwa die Technik der Soundsystems und den damals noch „Toasting“ genannten Sprechgesang – mit afroamerikanischen Stilen wie Rhythm and Blues und Soul verbanden. Die Vorstellung, dass nur Jamaikanerinnen und Jamaikaner Reggae spielen dürfen, enthält also ihrerseits ein rassistisches Stereotyp: Sie will eine hoch entwickelte, von Aneignungen getragene und zu Aneignungen einladende Musik wieder auf den künstlerisch schlichten Ausdruck einer „indigenen“ Identität reduzieren.
Darin hat der konservative Spott über die „woke Linke“ seinerseits seinen wahren Kern. Wer über kulturelle Aneignungen nur noch im Modus des Verbots reden kann, der übersieht ihre schöpferische und auch emanzipatorische Kraft – und dass es in Wahrheit überhaupt keine Kultur ohne sie gibt. Dagegen wäre eine Ethik der Appropriation zu setzen, die einerseits die Machtverhältnisse reflektiert, die jegliche Kultur schon immer durchziehen – die aber andererseits um die Ursprungslosigkeit aller kulturellen Verhältnisse weiß und um die schöpferischen und emanzipatorischen Kräfte der Aneignung. Eine solche Ethik müsste sich also nicht in der Form des Verbots konstituieren, sondern vielmehr in der Form des Gebots: Appropriiere! Aber tu es richtig! Das allerdings geht am besten im Dialog: in gemeinsamer Reflexion statt im Modus der Empörung.
Jens Balzer, 1969 geboren, ist Schriftsteller und Autor im Feuilleton von Die Zeit. Gemeinsam mit Tobi Müller kuratiert er den Popsalon am Deutschen Theater Berlin, er ist künstlerischer Berater des Donaufestival Krems und hat zahlreiche Bücher zur Kulturtheorie und Gesellschaftsgeschichte verfasst. Zuletzt erschienen: High Energy: Die Achtziger – Das pulsierende Jahrzehnt (Rowohlt Berlin, 2021), Schmalz und Rebellion – Der deutsche Pop und seine Sprache (Dudenverlag, 2022), Ethik der Appropriation (Matthes & Seitz Berlin, 2022) und No Limit: Die Neunziger – das Jahrzehnt der Freiheit (Rowohlt Berlin, 2023).
Bardentreffen 2023
Das 46. Bardentreffen in Nürnberg greift mit seinem Motto „Geklaute Laute?“ die Diskussion um kulturelle Aneignung und musikalische Anerkennung auf. Allein das wieder aktuelle Trends aus Weltmusik, Folk und Global Pop präsentierende Programm zeigt, dass die Musikwelt voller Aneignungen ist – mit Acts wie den Congo Cowboys aus Südafrika, dem Orchestre International du Vetex aus Belgien, dem deutschen Quartett Cara und vielen anderen mehr. Um das Ganze theoretisch zu unterfüttern, finden unter Federführung des folker im Pfarrhof und Kapitelsaal von St. Sebald Interviews, Diskussionen und Vorträge zum Thema statt. Zu Gast sein wird dort auch Jens Balzer mit einem Impulsvortrag zur historischen Einordnung des Begriffsfelds.

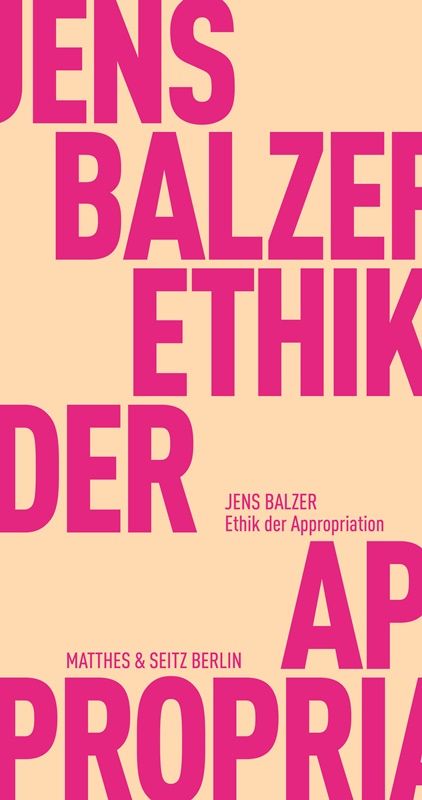








0 Kommentare